Yoga von yuj – als Verbindung
Die gängige Sanskrit Herleitung des Wortes Yoga führt dieses auf die Verbalwurzel yuj zurück [Williams 1899, Böthlingk 1855–1875]. Diese Verbalwurzel bedeutet „verbinden“, „anschirren“, „zusammenjochen“ oder „vereinigen” [Whitney 1885]. Somit bedeutet “Yoga” “Verbindung” oder “Vereinigung” [Böthlingk 1855–1875, Williams 1899].
Diese Deutung verweist im übertragenen Sinn auf das Streben nach Einheit. Diese Einheit kann sich zum Beispiel zwischen Körper und Geist, zwischen Individuum und Kosmos oder zwischen verschiedenen Aspekten des eigenen Bewusstseins einstellen.
Diese entspricht dem heute weit verbreiteten Verständnis einer Yogapraxis. Auch in den traditionellen Sichtweisen der tantrischen sowie der Vedānta-Philosophie spiegelt sich diese Bedeutung wider. In diesen Systemen ist nämlich das Verschmelzen des individuellen Bewusstseins mit dem Absoluten ein zentrales Konzept:
- Tantrismus: Im Tantrismus erkennen wir unsere Einheit mit Paramārtha oder lassen die Polaren Kräfte von śiva-śakti sich miteinander vereinigen.
- Vedanta: Im Vedanta verschmilzt unser Individuum (ātman) mit dem Absoluten (brahman).
Beides deckt sich gut mit der Grundbedeutung „verbinden“.
Praxisbezug: Für viele Praktizierende bedeutet Yoga vor allem Integration und Harmonie. āsana (Yogahaltungen) können beispielsweise Körper und Atem miteinander vereinen, während Prāṇāyāma (Atemübungen) das Zusammenspiel von Körper und Geist fördert. Auch in der Meditation wird das Bewusstsein nach innen gelenkt, um eine tiefere Verbindung zum eigenen Selbst zu erfahren. Wer Yoga so praktiziert, betont meist das Empfinden von Ganzheit und innerem Einklang.
Yoga von yuch – als Trennung
Ich begegnete kürzlich jedoch einer provokanten Gegenthese: Nach dieser sei yoga nicht von yuj = „verbinden“, sondern von yujir = „trennen“ abgeleitet. Yuir konnte ich zwar nicht in meinen Sanskrit Wörterbüchern finden. Doch yuch = “trennen” [Whitney 1885].
Gerade im Kontext der Sāṃkhya-Philosophie – einer dualistischen Denkrichtung, die puruṣa (reines Bewusstsein) und prakṛti (Materie/Natur) als strikt getrennt ansieht – wirkt diese Sichtweise durchaus stimmig. Sāṃkhya bildet zudem die Grundlage für das Yoga-sūtra und das ausführlichere Yoga-śāstra des Weisen Patañjali.
In diesen Texten wird die „Trennung“ von puruṣa und prakṛti betont. Dabei ist puruṣa das reine, unveränderliche Bewusstsein, während prakṛti alle äußeren und inneren Vorgänge (Natur, Gedanken, Emotionen) umfasst. Auch die Begriffe draṣṭā (Sehender) und dṛśya (Gesehenes) machen diese Unterscheidung deutlich: Erst wer sich als draṣṭā erkennt, verwechselt sich nicht mehr mit dem dṛśya.
Die Befreiung (kaivalya) liegt genau in diesem Loslösen von allen Objekten und Wahrnehmungen. Erst wenn der Sehende erkennt, dass er nicht das Gesehene ist, wird wahre Freiheit erlangt.
Praxisbezug: Wer nach einer Sāṃkhya Sicht Yoga übt, legt den Fokus auf das Loslassen von allem, was nicht zum wahren Selbst gehört. In der Praxis bedeutet das etwa, störende Gedanken oder Anhaftungen zu beobachten, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Die Konzentration (Dhyāna) wird eingesetzt, um Klarheit über das eigene Wesen zu erlangen und sich von äußeren wie inneren Ablenkungen zu distanzieren. Dieses „Trennen vom Unwesentlichen“ dient letztlich dem Erkennen des reinen Bewusstseins als unveränderlichem Kern.
Was ist dran?
Eine sprachliche Analyse
Die Sanskritwurzel yuj hat verschiedene Varianten. Neben yuj selbst begegnen uns auch yujir oder yunch, die jeweils unterschiedliche Bedeutungsnuancen annehmen können (z. B. „beherrschen“, „sich konzentrieren“, „lösen“). Immerhin existiert die Verbalwurzel yujir mit der Bedeutung “trennen”, “lösen”.
Trotz dieser Varianten herrscht in der Sanskrit-Philologie weitgehend Einigkeit, dass sich yoga vor allem von yuj = „verbinden“, „anschirren“ oder „zusammenjochen“ ableitet. Diese am weitesten verbreitete Lehrmeinung gründet auf zahlreichen philologischen Belegen und legt daher nahe, dass „Vereinigung“ die ursprüngliche Bedeutung von yoga ist.
Eine philosophische Analyse aus der Sāṃkhya Sicht
Auch wenn die Bedeutung “Verbindung” zunächst mit der Sāṃkhya-Philosophie im Widerspruch zu stehen scheint, denn diese Sichtweise basiert auf einer „Trennung“. Aus Sicht von sāṃkhya–yoga wird durch das klare Erkennen des reinen Bewusstseins (Sehenden) gerade all das getrennt, was nicht zum Selbst gehört. Dort wird puruṣa letztlich von allem Nicht-Selbst „getrennt“, was aber wiederum als höchste Verbundenheit mit dem wahren Selbst verstanden werden kann.
Literaturangaben
Böhtlingk, O., & Roth, R. (1855–1875). Sanskrit-Wörterbuch (Vols. 1–7). St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
Williams, M. (1899). A Sanskrit-English dictionary: Etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages (New ed., greatly enlarged and improved). Clarendon Press.
Whitney, W. D. (1885). The roots, verb-forms, and primary derivatives of the Sanskrit language: A supplement to his Sanskrit grammar. Leipzig: Breitkopf & Härtel.
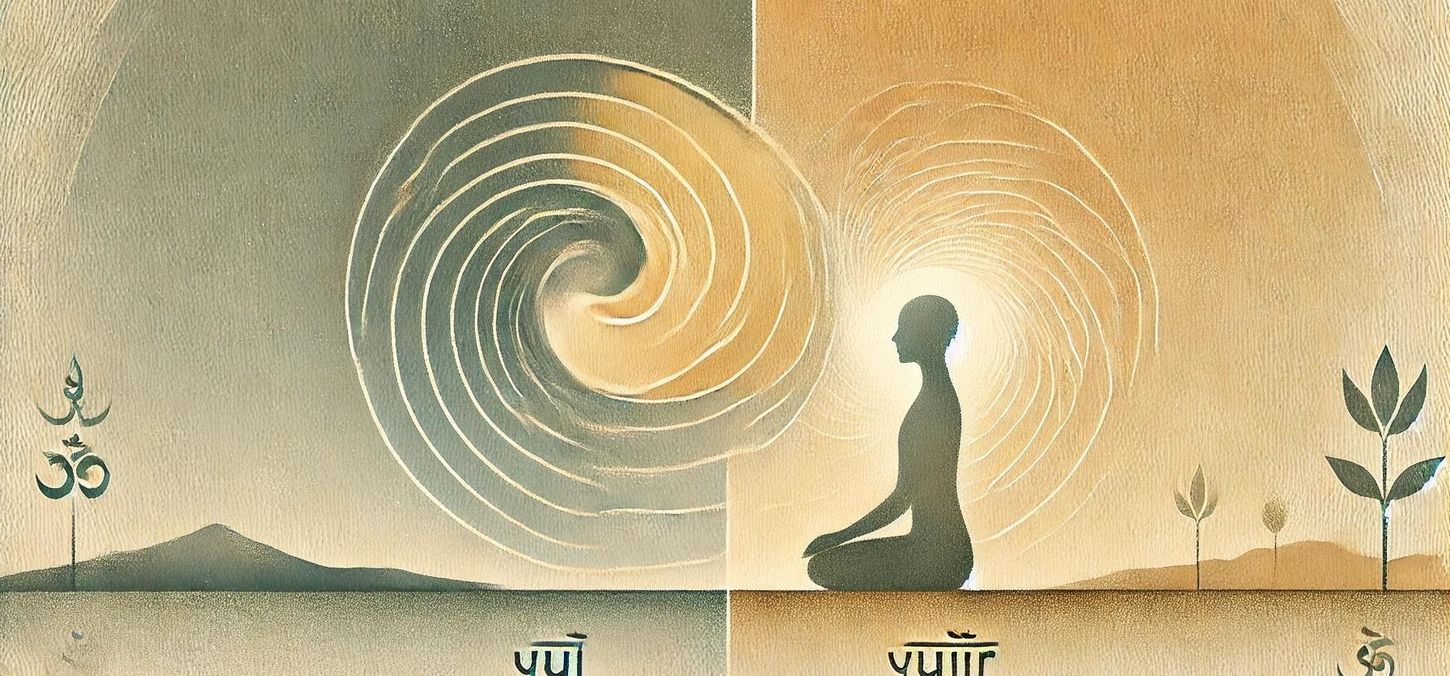

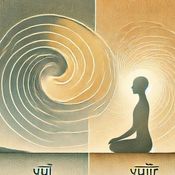
 Dr. Ronald Steiner
Dr. Ronald Steiner